 |
Mansfelder
Bergbau & Hüttenwesen |
 |
Der Hüttengrund bei Helfta
(Ergänzter
Nachdruck aus "Neue Mansfelder Heimatblätter"
Nr.5)
von Dr.
Wolfgang Eisenächer
1999
Hüttengrund - eine
Eindeutige Bezeichnung in einem Gebiet
"uralten" Bergbaus, was vermuten
lässt, dass auch der Name "uralt" ist
und bis in die Entstehungszeit des hiesigen
Bergbaus hineinreicht, ähnlich dem Schmalzgrund
bei Hettstedt. Aber dies ist ein Irrtum:
Seinen Namen hat das nur 5 km lange Tälchen erst
zu einer Zeit erhalten, als längst wieder Ruhe
eingekehrt war und nur noch Halden von seiner
industriellen Vergangenheit kündeten, und bei
der Namensgebung mag wohl auch die schmerzliche
Sehnsucht nach der Zeit der Prosperität Pate
gestanden haben.
In der Zeit, als hier noch die Hütten rauchten,
in denen der Kupferschiefer zu silberhaltigem
Schwarzkupfer verschmolzen wurde, hieß dieser
Grund schlicht "Das Tal" oder "Tal
vor Eisleben". Die ältere Bezeichnung
"Teufelstal", aus dem späten
Mittelalter stammend, verschwand sehr rasch mit
der Ausbreitung der Reformation. Aber noch immer
klingt sie an im "Teufelsgrund" und
"Teufelskanzel", dem einzigen
Nebentälchen und der dort befindlichen
Felsbildung.
Von den Hütten selbst haben wir nur sehr
spärliche Nachrichten. 1508 wird zum ersten Male
eine Hütte im Tal erwähnt, 1532 sind es fünf,
von denen eine schon "wüst" ist,
während eine weitere bis 1535 stillgelegt wird.
das heißt jedoch nicht, dass die Hütten erst
nach 1500 entstanden sind; die Gründungszeit
liegt mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen
1440 und 1470. Fünf Hütten auf zwei Kilometer
Talstrecke sind eine beachtliche industrielle
Ballung, gaben sie doch unmittelbar 55 - 60
Hüttenleuten sichere Arbeitsplätze und
verursachten ein reges Verkehrsgeschehen.
Sie verarbeiteten um 1520 jährlich
5000 Fuhren Erz (je 1,2 Tonnen),
6000 Fuhren Holzkohle,
1000 Fuhren Holz,
500 Fuhren Flußspat
und erzeugten 150 Tonnen Kupfer mit 800 kg Silber
im Jahr. Der Wert dieser Metalle ist größer als
die Produktion manches namhaften
zeitgenössischen Bergbaureviers, wie z.B.
Andreasberg im Harz oder Marienberg im
Erzgebirge.
Holz und Holzkohle kamen nicht aus den
benachbarten Wäldern des Hornburger Sattels.
Diese Waldflächen sind viel zu klein, um den
enormen Holzbedarf für die Holzkohlenherstellung
zu genügen. Der gesamte Holznachwuchs aus den
etwa 6 km² Waldfläche, wovon jedoch weit über
50 % Gemeindewald und interner Nutzung
vorbehalten war, erbrachte jährlich maximal 2000
Festmeter Holz, die 500 Fuder Holzkohle ergaben,
0,7 % des Gesamtbedarfs der Hütten oder
ausreichend für den Betrieb eines Feuers für 32
Wochen. Die Holzkohle kam aus dem Südharz, aus
den Wäldern um Solberg - Benneckenstein. Auch
das Erz kam nur zum kleinsten Teil aus den Gruben
am Nordost-Abfall des Hornburger Sattels, aus den
Revieren "am Holze" oder
"Lindental", im Bereich der heutigen
Waldgrenze, sondern aus dem Bergbaugebiet
zwischen Wolferode und Ziegelrode.
Es ist erstaunlich, wie dem infolge des kleinen
Einzugsgebietes nur sehr wenig Wasser führenden
Hüttengrundbach die für den Antrieb der
Gebläse erforderliche Energie abgewonnen worden
ist, wie sorgfältig das geringe Energieangebot
genutzt wurde. Der Bach entspringt im
(gegenwärtig kaum noch Wasser spendenden)
Dorfbrunnen / Dorfteich in Schmalzerode und wird,
da Nebentäler fehlen, nur noch durch
Sickerwasser aus einigen feuchten Wiesen
gespeist. Nach ca. 3 km Oberlauf beginnt ab
Neckendorf die "Gefällstufe". Auf zwei
Kilometer Lauflänge fällt der Bach um 60 m. Nur
hier lässt sich ausreichend Energie entnehmen.
Es waren bei der geringen Wassermenge 10 m
"hohe" Wasserräder erforderlich. Jede
Hütte nutzte 10 m vom Gefälle. Das
Abschlagwasser der oberen Hütte wurde in
sorgfältig nivellierten, am Hang
entlanggeführten Gräben dem Wasserrad der
nächst tiefer gelegenen Hütte zugeführt. |
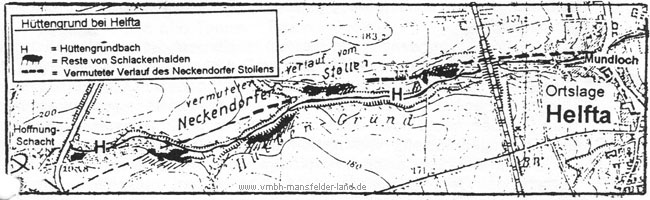
Die industrielle Blüte zog
aber auch den Verfall nach sich. Um die Gruben am
Nordost-Abfall des Hornburger Sattels zu
entwässern, wurde um 1500 der Roß- oder
Neckendorfer Stolln im Untergrund des
Hüttengrundes getrieben. Nachdem er die
Schächte erreicht hatte, verringerte sich durch
Wasserentzug bzw. Versickerung die Wasserführung
des Baches, die Hütten litten unter
Energiemangel. 1511 schon muss eine
Wasserhebeeinrichtung Wasser aus den Schächten
trotz vorhandenseins des Stollens "bis zu
Tage" heben, um den Schmelzbetrieb der
Hütten sicherzustellen. Eine Intensivierung der
Schmelzarbeit um 1515 ermöglichte ein
Hinausschieben der Betriebseinstellung. Die
verfügbare Erzmenge konnten nun die Hütten in
der Hälfte der Zeit gegenüber bisher
verschmelzen. Die Schmelzkampagnen erstreckten
sich nach 1515 nicht mehr über das ganze Jahr,
sondern nur noch auf die wasserreiche Zeit vom
zeitigen Frühjahr bis zum Frühsommer. Aber -
und das deutet die aufgelassene und in teilweisem
Aufgeben befindliche Hütte 1535 an - der
Hüttenstandort im "Tal vor Eisleben"
mit den Erbhütten Drachstedt, Brückner und
Heidelberg und den gräflichen Hütten Heidelberg
und Wiedemann (das sind die Namen der Inhaber
bzw. Besitzer) muss zwischen 1540 und 1550
aufgegeben werden, auch wegen ihrer gegenüber
anderen Anlagen weiteren Anfuhrwege für das Erz.
Erst etwa 100 Jahre danach, nachdem das Tal in
seine Ruhe zurückgefallen war, taucht, in
Erinnerung an die Zeit einer schwunghaften
industriellen Tätigkeit, der
"Hüttengrund" in Urkunden auf. Und
Dank dieser durch die teilweise Wegelosigkeit
bedingten Ruhe des Tals sind die Sachzeugen der
ehemaligen Hüttenbetriebe, die Schlackenhalden
von zwei Hütten, nahe unversehrt noch erhalten.
Sie erwecken den Eindruck von
Talschotterterrassen; angewehter Staub hat eine
Trockenrasennarbe entstehen lassen, die nichts
mehr vom Schlackenuntergrund erkennen lässt.
Deutlich stellen sich noch die ehemaligen
Wasserabschlaggräben als tiefe Einbuchtungen in
den Haldenkanten dar. Die Halde der unteren
Hütte, unmittelbar am Bahndamm, scheint
weitgehend zur Dammschüttung mit verwendet
worden sein.
Der 1950/60 vorhandene relativ geringe Haldenrest
der obersten Hütte1) ist
bei der Verfüllung des Erdfalles an der B 180
und der Verbreiterung der Straße fast restlos
verarbeitet worden. Nur noch Schlackestückchen
im Boden weisen auf die damalige Halde hin. Dies
ist aber auch alles, wenn man von den heute noch
unter den Rauchschädennachwirkungen leidenden
Talhängen absieht. Noch nach 400 Jahren
"Erholungszeit" gestattet der Boden nur
ein kümmerliches Fortkommen der
Fichtenpflanzungen. In Anbetracht des
Originalzustandes der beiden Halden, ihres Alters
und der Tatsache, dass es die einzigen
unbeeinflusst gebliebenen Sachzeugen des
Hüttenbetriebes im gesamten Mansfelder
Bergbaugebiet aus der Zeit vor dem 30jährigen
Kriege sind, sollten sie unbedingt erhalten
werden, zumal ihre Beseitigung weder eine
Notwendigkeit ist noch zur Rekultivierung von
Bodenflächen führt.
1)
Die schon 1531 "wüst gelegene"
Drachstedt'sche Hütte; ihre 2 "Feuer"
- Betriebsgerechtigkeiten, Erz- und Kohlequoten -
waren von den beiden Drachstedt'schen Hütten in
Wimmelburg und "unter dem roten Berge"
- Kreisfeld - übernommen worden |
<<< Zurück
>>>
© Verein Mansfelder Berg- und
Hüttenleute e.V.
|